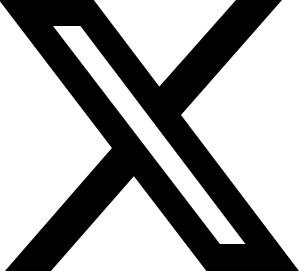Im Projekt INPART der Hochschule Bremen geht es um die Frage, wie Forschung inklusiver gestaltet werden kann – insbesondere in der Technikentwicklung mit und für Menschen mit Behinderung. Ziel ist es, konkrete Empfehlungen für gelungene partizipative Forschung zu entwickeln. Im Interview mit Katharina Gerl berichten die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen Dr. Barbara Neukirchinger und Bertold Scharf über Erfahrungen aus dem ersten Co-Creation-Workshop, Herausforderungen bei der Umsetzung und Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit behinderten Forschenden.
Was ist das Projekt INPART?
Neukirchinger: INPART steht für „Inklusive Partizipation durch integrierte Forschung“. Unser Ziel ist es, Empfehlungen für gelungene Partizipation in der Forschung zu Technikentwicklung mit behinderten Menschen zu entwickeln. Denn bisher sind behinderte Menschen in der Forschung als Forschende oder Co-Forschende unterrepräsentiert. Gleichzeitig werden Barrierefreiheit und Inklusion in der Forschung bisher zu wenig berücksichtigt und behinderte Menschen häufig erst spät einbezogen – oft dann, wenn ein Produkt schon fast fertig ist und kaum noch Änderungen möglich sind. Wir wollen durch das Projekt Wissen bereitstellen und Hilfestellungen dafür geben, gute und inklusive Partizipation in der Forschung und Technikentwicklung umsetzen zu können.
Was bedeutet „integrierte Forschung“ in diesem Zusammenhang?
Neukirchinger: Integrierte Forschung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Dieser Forschungsansatz berücksichtigt sowohl ethische, soziale und rechtliche Aspekte und betont den gesellschaftlichen Kontext bzw. umgekehrt die gesellschaftlichen Auswirkungen von Forschung. Für uns bedeutet das, Barrieren und Ausschlüsse in der Technikentwicklung sichtbar zu machen und zu fragen, welche Bedarfe von behinderten Menschen bisher übersehen werden. Wenn behinderte Menschen als Co-Forschende mitarbeiten, entstehen Ergebnisse, die gesellschaftlich relevanter und nachhaltiger sind, weil tatsächliche Bedarfe erkannt und verstanden werden – auch wenn der Weg dahin mitunter aufwändiger ist.
Ihr selbst bezieht Co-Forschende im Rahmen von Workshops in euer Projekt ein. Welche Rolle spielen die Co-Creation-Workshops im Projekt?
Neukirchinger: Die Co-Creation-Workshops sind das partizipative Element in unserem Projekt. Mit ihnen wollen wir sicherstellen, dass wir selbst nicht an den Interessen der Beteiligten vorbeiplanen In den Workshops tauschen wir uns mit Forschenden und Co-Forschenden aus, die selbst in diesem Feld aktiv sind oder Erfahrung mit Behinderung und Partizipation haben. Wir stellen unsere Zwischenergebnisse vor, holen Rückmeldungen ein und diskutieren gemeinsam, was gute inklusive Forschung ausmacht. So fließen unterschiedliche Perspektiven direkt in unsere Projektarbeit ein.
„Wenn behinderte Menschen als Co-Forschende mitarbeiten, entstehen Ergebnisse, die gesellschaftlich relevanter und nachhaltiger sind, weil tatsächliche Bedarfe erkannt und verstanden werden – auch wenn der Weg dahin mitunter aufwändiger ist.“
Barbara Neukirchinger
Welche Perspektiven waren im ersten Workshop vertreten?
Scharf: Es haben acht Personen aus verschiedenen Bereichen teilgenommen – Wissenschaft, Bildung, Barrierefreiheit und Selbstvertretung. Gemeinsam war ihnen, dass sie entweder als Wissenschaftler*innen oder Co-Forschende an partizipativen Projekten teilgenommen hatten und selbst eine Behinderung haben. Wir hatten Teilnehmende aus den Disability Studies und der Teilhabeforschung, ein Werkstattrat, Forschende aus dem Bereich Autismus, eine Bildungsfachkraft, eine Lehrkraft sowie einen Berater für Barrierefreiheit und inklusiven Tanz. Dadurch kamen viele unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungswelten zusammen.
Barrierefreiheit ist für eurer Projekt ein wichtiges Thema: Wie habt ihr selbst Barrierefreiheit beim Workshop sichergestellt?
Neukirchinger: Wir haben bereits bei der Organisation auf eine barrierefreie Workshopgestaltung geachtet. Wir haben frühzeitig eine umfangreiche Bedarfsanalyse mit allen Beteiligten durchgeführt, um individuelle Anforderungen zu ermitteln – etwa zu Assistenz, Pausen oder technischer Ausstattung. Auch eine externe Moderation mit Erfahrung in Co-Creation-Formaten war eingebunden. Wichtig für eine gleichberechtigte Teilnahme war zudem der finanzielle Aspekt: Wir übernahmen eine Aufwandsentschädigung sowie Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung, damit wirklich alle unabhängig von den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten teilnehmen konnten.
Welche Erfahrungen und Erkenntnisse habt ihr aus dem Workshop mitgenommen? Gab es Themen oder Diskussionen, die euch überrascht?
Neukirchinger: Besonders eindrücklich war, wie engagiert und offen diskutiert wurde. Immer wieder kam die Frage auf, warum Barrierefreiheit in Forschungsvorhaben noch so häufig vernachlässigt wird. In Bezug auf partizipative Forschung wurden Themen wie die Einbeziehung von Expert*innen, fachliche Kompetenz und faire Entlohnung, Partizipation und ihre Messbarkeit, Herausforderungen in der Technikentwicklung, Finanzierung und Priorisierung intensiv besprochen. Wir haben viele Anregungen für unseren Kriterienkatalog gewonnen, mit dem wir partizipative Projekte künftig auswerten wollen.
Scharf: Sehr dominant bei den Diskussionen im Workshop war das Thema, wie partizipative Forschung möglichst barrierefrei und zugänglich gemacht werden kann. Hinzu kamen die Fragen von Machtverhältnissen in der Forschung: Wer hat das Sagen und inwiefern können die Co-Forschenden auch tatsächlich etwas zu den Ergebnissen beitragen? Interessant fanden wir auch die Diskussion um die Frage, was eigentlich ein gutes, barrierefreies Produkt ausmacht und wie sich das messen lasst. Auffällig war auch, wie stark Zeit und Energie eine Rolle spielen. Wieviel Zeit benötigen wir, um zu guten Ergebnissen zu kommen? Und wieviel Zeit benötigen wir auch, um alle auf den gleichen Stand zu bekommen, um eine gute Diskussion auf Augenhöhe führen zu können? Einige Teilnehmende brauchen längere Pausen oder eine andere Arbeitsweise – das muss in der Planung berücksichtigt werden.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung für inklusive Partizipation?
Scharf: Digitalisierung kann hier sowohl Chance als auch Barriere sein. Digitale Tools ermöglichen oft erst eine selbständige Teilnahme – etwa durch Screenreader oder Videokonferenzen. Gleichzeitig sind viele digitale Anwendungen selbst nicht barrierefrei oder schwer zu bedienen. Ein Beispiel sind Gebärdensprach-Avatare, die in der Community teils kritisch gesehen werden. Auch hier gilt: Ohne die Perspektive der Betroffenen einzuholen läuft man Gefahr, keine Akzeptanz für eine technische Lösung zu erzielen.
„Viele Maßnahmen der Barrierefreiheit – etwa klare Kommunikation oder Pausen – kommen allen zugute. Und: Man muss nicht alles perfekt machen. Entscheidend ist, sich auf den Weg zu machen und bereit zu sein, dazuzulernen.“
Bertold Scharf
Wie geht es im Projekt jetzt weiter?
Neukirchinger: Wir haben inzwischen mehrere Projekte ausgewählt, die wir als Fallstudien im Hinblick auf gute Partizipation untersuchen werden. Mit Hilfe der Workshop-Ergebnisse finalisieren wir gerade unseren Kriterienkatalog und bereiten Interviews mit Beteiligten aus diesen Projekten vor. Die Ergebnisse möchten wir im kommenden Jahr auf Konferenzen und Netzwerkveranstaltungen vorstellen. Außerdem ist ein zweiter Workshop geplant, bei dem wir unsere Erkenntnisse erneut zur Diskussion stellen
Basierend auf euren Erfahrungen: Welche Tipps gebt ihr anderen Forschenden, die partizipativ mit behinderten Menschen arbeiten möchten?
Neukirchinger: Am wichtigsten ist, behinderte Menschen von Anfang an einzubeziehen – idealerweise schon bei der Antragstellung oder Themenfindung. Bedarfsanalysen helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Unser Institut, das Institut für Digitale Teilhabe (IDT), bezieht sehr viel Expertise daraus, dass die Forschenden selbst überwiegend Menschen mit Behinderungen sind. In dieser Hinsicht ist das IDT ein Glücksfall, weil behinderte Forschende nach wie vor stark unterrepräsentiert sind und mehr behinderte Mitarbeiter*innen in der Forschung wünschenswert wären.
Scharf: Das Thema Barrierefreiheit erscheint erstmal sehr komplex. Es ist aber, glaube ich, für alle Projekte relevant, selbst wenn die Zielgruppe nicht hauptsächlich behinderte Menschen sind. Denn wenn bei einem Projekt auf Grund mangelnder Barrierefreiheit keine oder nur bestimmte Gruppen mitmachen können, dann verzerrt das auch die Forschungsergebnisse. Viele Maßnahmen der Barrierefreiheit – etwa klare Kommunikation oder Pausen – kommen allen zugute. Und: Man muss nicht alles perfekt machen. Entscheidend ist, sich auf den Weg zu machen und bereit zu sein, dazuzulernen. Denn zum einen ist eine barriereärmere Veranstaltung schon einmal besser als gar keine oder eine unzugängliche. Zum anderen gibt es einfach Bedürfnisse, die sich widersprechen. Sehr lange Pausen können für manche Personen bspw. auch eher frustrierend sein. Es ist meine Empfehlung, sich erstmal Gedanken über Barrierefreiheit zu machen. Wenn sich dann aus finanziellen oder zeitlichen Gründen nicht alles umsetzen lässt, dann sind wir hier bei strukturellen Problemen angekommen, die sich nicht immer innerhalb eines Projektes lösen lassen.
Was habt ihr persönlich als Forschende aus dem Workshop gelernt?
Neukirchinger: Wie wichtig Zeit, Vorbereitung und Kommunikation sind. Die Bedarfsanalyse und die Vorabgespräche waren sehr hilfreich, um Bedürfnisse zu verstehen. Auch organisatorisch haben wir viel gelernt – etwa, wie wertvoll es ist, Räumlichkeiten vorher auf Barrierefreiheit zu prüfen.
Scharf: Wir konnten anhand des Workshops selbst ausprobieren, wie eine Bedarfsanalyse funktioniert. Beim Workshop selber waren wir einerseits Teil der Diskussion, wollten aber natürlich auch die Diskussionen nicht zu stark dominieren. Das hat aber insgesamt sehr gut geklappt und wir haben positives Feedback bekommen.
Dr. Barbara Neukirchinger und Bertold Scharf sind wissenschaftliche Mitarbeitende am Institut für digitale Teilhabe an der Hochschule Bremen und forschen dort unter anderem im Projekt INPART.