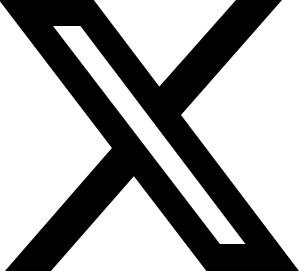5. Fachkonferenz Integrierte Forschung: Dokumentation & Bericht
Vom 31. März bis zum 1. April 2025 fand in Düsseldorf die 5. Fachkonferenz Integrierte Forschung unter dem Titel „Perspektiven offener Wissenschaften in einer digitalisierten Demokratie“ statt. Veranstaltet vom BMBF-geförderten Cluster Integrierte Forschung, versammelte die Konferenz an zwei Tagen Vortragende aus inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten, um über die Potentiale und Herausforderung der Integration partizipativer Elemente in Forschungsprojekte zu diskutierten. Verbunden damit war die Frage, wie sich Forschung für die gesellschaftliche Teilhabe produktiv öffnen lässt und wo Grenzen der Öffnung liegen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Projekten aus dem Bereich Technikentwicklung mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) sowie auf Fragen der Inklusion im Kontext offener Wissenschaft.
Die Konferenz bot eine gute Plattform für den inter- und transdisziplinären Austausch und zeigte, wie wichtig die Öffnung von Wissenschaft für die Gesellschaft ist. Besonders anregend war die Vielfalt der vorgestellten Projekte und die Offenheit der Diskussionen.
Themen und Inhalte
Die Konferenz beleuchtete im Rahmen von die in wissenschaftlichen Vorträgen, Workshops und Posterbeiträgen vielfältige Themen rund um offene Wissenschaft und integrierte Forschung. Ein Highlight gleich zu Beginn war die Keynote von Dr. Benedikt Fecher (Wissenschaft im Dialog), der sich in seinem Vortrag mit Verschiebungen an den Grenzen zwischen Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft auseinandersetzte.
Keynote von Dr. Benedikt Fecher (Wissenschaft im Dialog) vom 31.03.2025. (c) Daniel Nehring
Nach der Keynote stellt sich das Cluster Integrierte Forschung vor. Dr. Bruno Gransche und Dr. Mone Spindler geben dazu Einblicke in die Teilcluster I und Teilcluster II. Anschließend leitet Dr. Katharina Gerl zu den Projekten im Teilcluster III über, die sich im Rahmen von Kurzpräsentationen vorstellen.
Nach der Mittagspause gaben Dr. Anna Soßdorf (Science on the Move), Dr. Ann Christin Schulz (TU Dortmund) und Yousra El Makrini (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) in der ersten Session „Integration vulnerabler Gruppen in partizipative Forschung“ Einblicke in Projekte, die sich mit den Gelingensbedingungen und Herausforderungen der Integration von Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung in partizipative Forschung auseinandergesetzt haben. Alle drei Sprecherinnen betonen die Bedeutung von Zeit für Community Building im Vorfeld der Projekte und die Vernetzung mit Multiplikatoren für den Projekterfolg. Für den Aufbau von Vertrauen zwischen Wissenschaftler*innen und Mitforschenden braucht es Zeit und geschützte Räume, was bei der Planung beachtet werden sollte. Dazu gehört z.B. auch Raum zum Spielen und eigener Gestaltungsspielraum, wie Yousra El Makrini am Beispiel des Aufbaus eines Kinderrats in der Gesundheits- und Versorgungsforschung zeigt. Damit einher geht auch notwendigerweise ein hohes Maß an Flexibilität im Forschungsprozess. Für die Ausgestaltung bieten die Projekte im Rahmen des Transfers wichtige Impulse und konkrete Empfehlungen.



Die Beiträge der parallelen zweiten Session widmeten sich aus unterschiedlichen Perspektiven der partizipativen Ausgestaltung der Digitalisierung. Zunächst gab Prof. Dr. Christian Djeffal (TU München) aus rechtswissenschaftlicher Perspektive einen Einblick in drei Projekte aus dem Bereich des „Legal Design“. Die Projekte widmen sich dem konstruktiven inter- und transdisziplinären Austausch zwischen Entwickler*innen, Stakeholdern und Wissenschaft, um einerseits frühzeitiges Feedback zu Chancen und Risiken neuer Technologien zu geben und andererseits eine rechtliche Einschätzung zu z.B. Haftungsfragen oder Sorgfaltspflichten abzugeben. Dr. Daniel Guagnin (nexus Institut) beleuchtet im Anschluss anhand aktueller Beispiele (z.B. X unter Elon Musk) Auswirkungen impliziter und expliziter Einschreibung von Normen und Wertvorstellungen in Technologien für den demokratischen Diskurs. Partizipative Technikgestaltung und der Ansatz des „Value Sensitive Design“ könne helfen, diese Normen und Werte zu reflektieren. Abschließend berichtet Dr. Dennis Frieß über die Erfahrungen und Herausforderungen mit den ko-kreativen Formaten im Projekt „Innovative Interventionen für diskursive Integration“ (INDI). Ziel des Projekts ist die ko-kreative Entwicklung und Testung von KI-basierten Interventionen, die dazu beitragen sollen, Online-Diskussionen inklusiver zu gestalten. Herausforderungen bestehen dabei z.B. in Bezug auf die wissenschaftliche Verwertbarkeit der erzielten Ergebnisse. Insgesamt unterstreichen die Vorträge die Bedeutung der gemeinschaftlichen Auseinandersetzung über Normen- und Werte im Rahmen von Technikentwicklung und die Relevanz der Einbindung unterschiedlicher Stakeholder in diesen Prozess, um Technologieentwicklung an den gesellschaftlichen Bedarfen und demokratischen Normen und Werten auszurichten.


Im Anschluss eröffnet die Podiumsdiskussion zum Thema „Citizen Engagement in der Klimawandelkommunikation – Wie kann ein konstruktiver Dialog in der Praxis gelingen“ eine weitere Perspektive auf offene Wissenschaft und nimmt dafür nun einen Perspektivwechsel von der Wissenschaft hin zur Kommunikationspraxis vor. Sven Egenter (Clean Energy Wire, klimafakten) und Henrike Welpinghus (Klimahaus Bremerhaven) geben im Gespräch mit Prof. Dr. Hannah Schmid-Petri (Universität Passau) Einblicke in die praktische Gestaltung von Kommunikationsformaten und partizipativ Wissenschaftskommunikation aus journalistischer und museumsdidaktischer Perspektive. Die Referent:innen zeigen auf, welche Rolle Journalismus und Museen als in der Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich Klimawandel einnehmen können und wie Klimawandelkommunikation partizipativ gestaltet werden kann.

Podiumsdiskussion „Citizen Engagament in der Klimawandelkommunikation – Wie kann ein konstruktiver Dialog in der Praxis gelingen?“. Auf dem Podium von links nach rechts: Prof. Dr. Hannah Schmid-Petri (Universität Passau), Henrike Welpinghus (Klimahaus Bremerhaven) und Sven Egenter (Clean Energy Wire, klimafakten). Foto: Rahel Bott
Der erste Konferenztag klingt mit viel Raum für Austausch und Vernetzung mit begleitender Poster-Session, der Pop-up Ausstellung zur Krisenkommunikation „Crisis Utopia“ von YOUSE sowie der Möglichkeit zum Ausprobieren von im Cluster entwickelten Demonstratoren aus den Projekten „KI in Bürgerbeiträten“ (KIB) und „Innovative Interventionen für diskursive Integration“ (INDI)“ aus.






Am zweiten Konferenztag steht die praktische methodische Umsetzung von partizipativen Formaten im Mittelpunkt. Eröffnet wird der Tag deshalb durch einen Input von Jonas Larbalette zum Thema „How to co-create?“. Er gibt aus Perspektive eines Facilitators für ko-reative Prozesse Einblicke in Herausforderungen für Co-Creation und zeigt Tools und Methoden auf, mit deren Hilfe diese Herausforderungen methodisch gelöst werden können.
Nach diesem gelungenen Einstieg in den zweiten Konferenztag geht es in fünf parallelen Workshops weiter, die ebenfalls Einblicke in die konkrete Gestaltung von Offenheit in Forschungsprojekten geben. Verena Müller (TU München) zeigt im Workshop „Shared Legal Assessment“ wie rechtliche Risiken von KI durch Partizipation erkannt, bewertet und vermieden werden können. Im Workshop „Die Macht der Menschenbilder: Reflektierte Technikgestaltung mit ADMIRE und Transformative Philosophy“ zeigen Dr. Bruno Gransche (KIT Karlsruhe) und Dr. Galia Assadi (Evangelische Hochschule Nürnberg) wie wirkmächtig Menschenbilder im Kontext von Technikentwicklung für die Interaktionsgestaltung und Rollenzuschreibungen sind. Gleichzeitig zeigen sie mit dem ADMIRE-Modell auf, wie implizite Menschenbilder methodisch angeleitet expliziert und so reflektiert werden können. Das Trainingsprogramm „Transformative Philosophy“ bietet in diesem Zusammenhang Orientierung und konkrete Trainings für Entscheider:innen der Technikgestaltung, -regulierung und -nutzung.

Josephine Schmitt vom Centre for Advanced Internet Studies (CAIS) stellt den CAIS-Forschungsinkubators vor. Dieser bindet Bürger:innen ko-kreativ bei der Entwicklung von Forschungsfragen und -programmen im Themenfeld der digitalen Transformation ein. Ziel ist es, gesellschaftlich relevante Lösungen zu erarbeiten und Raum für die Mitgestaltung der Digitalisierung zu bieten. Zur Mitgestaltung regt auch der Workshop von Lukas Baumann und Marie-Christin Lueg (TU Dortmund) an. Im Workshop „Hands-on Methode in der partizipativen Entwicklung von KI-gestützten Technologien: Spielerisch Partizipation gestalten“ wurden Potenziale von spielbasierten Methoden zur partizipativen Technologieentwicklung interaktiv erarbeitet. Dazu wurde eine im Projekt „KARLA – Kommunikationsassistenz in relevanten Lebensbereichen für Alle“ entwickelte Methode von den Teilnehmenden getestet und der Einsatz in Technologieentwicklungsprojekten diskutiert.
Der Workshop „Wie viel Zeit braucht Partizipation? Zeit als Herausforderung für (barrierefreie) Beteiligungsprozesse“ von Prof. Dr. Detlef Sack, Emilia Blank, Nora Freier (Universität Wuppertal) und Bertold Scharf sowie Dr. Barbara Neukirchinger (Hochschule Bremen) nimmt sich einer der zentralen Herausforderungen bei der Gestaltung von offener Wissenschaft an: Der Einbindung möglichst vieler Bürger*innen bei gleichzeitig begrenzten zeitlichen Ressourcen im Forschungsprozess. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wurde u.a. reflektiert welche Rolle Zeit und Zeitdruck in Partizipationsprozessen spielen und diskutiert, welche (technischen) Möglichkeiten es gibt, um die Exklusion partizipativer Prozesse zu verringern. In zwei Kleingruppen wurde dazu der Ablaufplan eines Bürgerrats aus der Perspektive unterschiedlicher Personas besprochen. Im Ergebnis kommen die Teilnehmenden zu dem Schluss, dass die Abwägung sehr unterschiedlicher Bedürfnisse im Hinblick auf den Faktor Zeit ein Spannungsfeld ist und dass Beteiligende diese unterschiedlichen Bedürfnisse so gut es geht bei der Planung ausbalancieren sollten. Allerdings kommen die Teilnehmenden auch zu dem Schluss, dass es keine für alle Bedürfnisse gleichzeitig optimale Lösung geben kann.






Zum Abschluss der Konferenz kamen die Teilnehmenden noch einmal im Plenum zusammen. Im Rahmen der interaktiven Podiumsdiskussion „Wie kommt Verantwortlichkeit in KI? KI-Ethik und praktische KI-Entwicklung im Dialog“ wurde erneut der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis gesucht. Moderiert wurde die Session von Dr. Mone Spindler (Universität Tübingen, IZEW), die gemeinsam mit Leonard Tröder (Birds on Mars GmbH) und Lisa Koeritz (Universität Tübingen, IZEW) sowie in der Diskussion mit dem Publikum darüber sprach, wie ethische Aspekte in die praktische KI-Entwicklung einfließen können.
Podiumsdiskussion „Wie kommt Verantwortlichkeit in KI“ vom 01.04.2025. Auf dem Podium von links nach rechts: Dr. Mone Spindler (IZEW, Universität Tübingen), Leonard Tröder (Birds on Mars GmbH) und Lisa Koeritz (IZEW, Universität Tübingen). (c) Daniel Nehring
Erkenntnisse & Takeaways
Ein zentrales Thema der Konferenz war die Frage, wie Forschung produktiv geöffnet werden kann, um gesellschaftliche Relevanz zu erhöhen und partizipative Elemente gewinnbringend in Forschungsprozesse zu integrieren. Drei Schwerpunktthemen hat die Konferenz dabei insbesondere in verschiedenen Formaten beleuchtet:
1. Die inklusivere und barriereärmere Gestaltung von offener Wissenschaft.
2. Die konkrete Ausgestaltung von offener Wissenschaft in Bezug auf Technikentwicklung mit Schwerpunkt auf (generative) KI.
3. Die methodische Umsetzung von Offenheit im Forschungsprozess
Im Rahmen der Konferenz konnte ein facettenreiches und diverses Bild offener Wissenschaft gezeichnet werden. In der Auseinandersetzung mit den Potentialen und Herausforderungen sind dabei vielfältige Überschneidungen sichtbar geworden. Als weiterer Auftrag an die Forschung bleibt die Notwendigkeit, sich mit den Grenzen und Grenzdynamiken auseinanderzusetzen, wie in der Keynote dargelegt. Auch die Frage danach wie und an welchen Stellen Forschungsprozesse unter den aktuellen strukturellen Bedingungen offen, inklusiv und integrativ sein können, bleibt auszuhandeln. Dazu braucht es auch mehr empirische Evidenz über die Wirkung partizipativer Forschung im Abgleich mit den Erwartungen. Vor allem aber hat der Austausch motiviert, sich den diskutierten Herausforderungen zu stellen und aus möglichen Spannungen produktive Ergebnisse abzuleiten.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für die Vorträge, Workshops, Projekteinblicke und Diskussionsbeiträge!