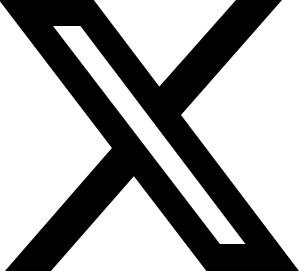Diskussionspapier zu Leitbegriffen einer Integrierten Forschung, Stand Januar 2024
Wozu positionieren wir uns?
Der Begriff »Integrierte Forschung« ist mehrschichtig: einerseits ist er vom BMBF programmatisch für den Bereich der Mensch-Technik-Verhältnisse gesetzt worden, um ein Zusammenwirken von Mensch und Technik zu markieren, das über ein einfaches Instrumentierungsverhältnis der Technik durch den Menschen und die Automatisierung von Prozessen hinausreicht. Andererseits sind ähnlich lautende Formulierungen schon vor Jahrzehnten eingebracht worden, um das Verhältnis von Forschung & Entwicklung in technikbasierten Projekten auf eine neue Grundlage zu stellen, die durch Interdisziplinarität, Komplexität und Partizipation geprägt ist. Wohl auch deshalb stößt das Konzept aktuell bei den Forschenden auf eine gewisse Resonanz, weil damit der Raum für neue Ansätze und Fragestellungen geweitet wurde. Darüber hinaus verdankt die Integrierte Forschung eine Reihe von Impulsen auch verwandten Programmen wie Responsible Research and Innovation (RRI), Technikfolgenabschätzung (TA), ELSI-Forschung, Value Sensitive Design. Die vielfältigen Anregungen aus verschiedenen Forschungsrichtungen sowie die pragmatische Verwendung des Begriffs bieten derzeit einen Experimentier- und Resonanzraum für Forschung, die sich um das breiter werdende Themenfeld digitalisierter Mensch-Technik-Verhältnisse dreht.
Mag der Begriff zunächst als Arbeitsbegriff eine vorläufige Rolle gespielt haben, könnte er nun zu einem noch zu konsolidierenden Programmbegriff weiterentwickelt werden. Weil der Begriff bereits eingeführt ist und an prominenten Stellen Verwendung gefunden hat, spricht zumindest aus dieser Warte viel dafür, an ihm festzuhalten und mit ihm weiterzuarbeiten. Diese Weiterarbeit muss dann notwendigerweise zur Schärfung des Begriffs und zur Konturierung des damit verbundenen Programms führen. Alle Beteiligten, d.h. das Ministerium als Förderungsinstanz wie auch die unter diesem Label Forschenden, haben so die Chance, Begriff und Programm kontinuierlich weiterzuentwickeln und diese beiden in der Praxis wie im akademischen Diskurs zu verankern. Hierzu ist es notwendig, der Entwicklung eines solchen Konzeptes den nötigen Rahmen (zeitlich, finanziell, ideell …) zu geben, damit dieses nicht nur auf den Weg gebracht, sondern kontinuierlich weiterentwickelt und so auch theoretisch abgesichert werden kann.
Das Teilcluster „Digitalisierte Lebenswelten“
Unter dem Dach des vom BMBF geförderten Forschungsclusters »Integrierte Forschung« haben wir in der Förderperiode 2021–2024 ein Konzept entwickelt, wie Integriertes Forschen an Leitbegriffen praktisch orientiert und so der Forschungsmodus selbst theoretisch fundiert werden kann. Anhand der Leitbegriffe »Lebenswelt«, »Lebensformen«, »Souveränität« und »Orientierung« bieten wir einen Beitrag zu einem Forschungsmodus, der einerseits diesen neu akzentuierten Mensch-Technik-Verhältnissen entspricht und andererseits es ermöglicht, die Verantwortung für ein Leben in digitalisierten Lebenswelten in Forschung und Entwicklung konkret wahrnehmen zu können. Die folgenden Seiten informieren erstens über das Verständnis und Verhältnis dieser Begriffe untereinander und in Bezug auf den Forschungsmodus, sie illustrieren dies zweitens an ausgewählten Beispielen und wollen drittens einen Beitrag zu einem breiten Diskurs um diesen Forschungsmodus und die spezifische Verantwortung der Forschenden hierin leisten.
Zum Verständnis und Verhältnis der Leitbegriffe
Lebensformen fungieren als Orientierungsrahmen für (idealerweise) souveräne Lebensvollzüge. Die Lebenswelt[1] wiederum stellt den Möglichkeitsrahmen für die jeweiligen Lebensformen dar. Eine Lebensform macht ein typisches Ensemble an miteinander kompatiblen Üblichkeiten, Rollen, Meinungen, Werthaltungen, Weltbildern etc. aus.
Technikgestaltung, also die Wahl und Herbeiführung neuer, verschiedener Technikformen, transformiert die bisherige Lebenswelt mitunter erheblich, kann damit die Bedingungen der Möglichkeit sowie des Gelingens und Scheiterns bestimmter Lebensvollzüge ändern und damit die jeweiligen, mit diesen Vollzügen assoziierten Lebensformen (als deren kollektiv-normative Bündelung).
Im Rahmen des Teilclusters Digitalisierte Lebenswelten kann Souveränität neben seiner staatsrechtlichen Bedeutung auch als die individuelle Fähigkeit verstanden werden, sich in gegebenen und gewählten kollektiven Lebensformen nach als eigene anerkannten Normen zu orientieren und nach dieser Orientierung handeln zu können. Diese Fähigkeit ist nicht als absolute Selbstbestimmung zu verstehen, sondern unterliegt stets Bedingungen und Einschränkungen. Das gleiche gilt für die kollektive Fähigkeit (und auch Notwendigkeit), Lebensformen neu zu wählen, weil Technik solche Neuorientierung erforderlich macht.
Bedingungen und Einschränkungen sind bspw.: historische und soziale Kontexte, (Recht, Üblichkeiten, Sanktionen, Interessen, Bereitschaften), situative Umstände, Stand und Verfügbarkeit von Technik etc. Entsprechend ist Souveränität nicht gleichzusetzen mit uneingeschränkter, absoluter Verfügungsgewalt und Selbstbestimmung, sondern schließt das Bewusstsein der jeweiligen Bedingtheiten und Hemmnisse mit ein und zeichnet sich gerade in einer zur Selbstdistanzierung fähigen Haltung diesen gegenüber aus.
Was leistet der Ansatz Integrierte Forschung?
Was leistet eine Perspektive auf Mensch-Technik-Verhältnisse im Modus der Integrierten Forschung mittels der Begriffe Souveränität, Orientierung, Lebensformen und Lebenswelt?Die Arbeit des Teilclusters geht von der Beobachtung aus, dass Digitalisierungsprozesse – wie zuvor auch schon andere Technisierungsprozesse – Lebensmöglichkeiten für einzelne Personen oder auch Gruppen und Gesellschaften eröffnen, andere aber auch verschließen. In dem Maße, in dem digitalisierte Prozesse und Endgeräte immer stärker in den persönlichen Lebensbereich vordringen, sind damit auch Lebensformen betroffen. Eine zentrale Frage für Technikgestaltungsprozesse erscheint uns deshalb, wie diese so orientiert werden können, dass Lebensformen in Pluralität gewählt und souverän gelebt werden können.
Bedingung für eine Wahl von Lebensformen (nach als eigene anerkannten oder zumindest nach nicht abgelehnten übernommenen Normen) ist die Kenntnis der typischen Elemente alternativer Lebensformen, d.h. Bedingung für eine Orientierung an Lebensformen ist ein Orientiertsein in Lebensformen – nicht zuletzt an und in den darin üblichen/bewährten Rollen, Weltbildern, Menschenbildern und Technikbildern.
Die (individuelle wie kollektive) Wahl einer Lebensform ist idealerweise ein souveräner Akt –in der genannten Beschränkung –, der an (individuellen wie kollektiven) Orientierungsprozessen anschließt. Solche Orientierungsprozesse nehmen (idealerweise) die vorausgegangenen Bedingungen, Einstellungen und Erwartungen kritisch reflexiv als eine Stufe des eigenen Orientiertseins auf und machen sie zum Ausgangspunkt für eine Neu-Orientierung mit neuen Bedingungen, Einstellungen und Erwartungen und unter der Maßgabe, die daraus resultierende Gestaltung von Technik – und damit von gestaltender Transformation von Lebenswelt/en, Lebensformen und Lebensvollzügen – ebenen- und akteursspezifisch zu verantworten.
Hierbei ist stets zu bedenken, dass Orientierung ein unabschließbarer, inkrementeller und explorativer Prozess ist. Als solcher baut er einerseits auf einem Schon-Orientiertsein auf und zielt andererseits auf Neuorientierung aufgrund mangelnder Passung zwischen Welt und diesem Orientiertsein. Idealerweise ist der Prozess der Orientierung eine bewusste kritisch reflexive Bewegung, die viele der meist impliziten Bedingungen, Einstellungen und Erwartungen expliziert und so einer Aushandlung zugänglich macht, anstatt unkritisch das bisherige Orientiertsein unter neuen Bedingungen nur fortzuschreiben.
Selbst bei angenommener prinzipieller Informiertheit und Orientiertheit: Manche Lebensformen stehen gar nicht mehr zur Wahl, manche nicht allen gleichermaßen, manche nur unter erhöhten (und ggf. zu hohen) Kosten; genauso wie innerhalb von Lebensformen nicht alle Elemente (wie z.B. Rollen) nicht allen zu jeder Zeit zur Disposition stehen. Als kollektiv-normative Gebilde leisten sie jedoch gerade bei einer Wahl (von Lebensvollzügen, Rollen, Haltungen etc.) Orientierungshilfe und zeichnen sich gerade nicht durch naturgesetzlichen Zwang aus.
Die gewählte Perspektive des Teilclusters der Digitalisierten Lebenswelten mittels der Begriffe Lebenswelt, Orientierung, Souveränität und Lebensformen leistet dreierlei:
- Integration von Kontext: Die Perspektive unterstützt dabei, Technikgestaltungsfragen in einem erweiterten und gegebenenfalls auch neuen Kontext zu reflektieren. Die gewählten Begriffe schaffen einen strukturierten Kontextzugang auch dort, wo er prima facie nicht naheliegt bzw. nicht ohnehin üblicherweise berücksichtigt wird. Technik funktioniert über Ursachenisolierung, also einem Ausschließen von dem wiederholten Gelingen zuwiderlaufenden Faktoren. Das gilt für adaptive oder sogar generative digitale Technik in einem verstärkten Maße. Außerdem trifft für diese Systeme in einem verstärkten Maße zu, was Niklas Luhmann die »andere Seite der Technik« genannt hat, nämlich bestimmte Gelingensbedingungen unsichtbar zu machen. Das ist unter Umständen bei datengetriebenen, adaptiven Systemen noch schwerer zu erkennen und reflexiv zu bearbeiten. Der DigiLe Begriffskonnex ist geeignet, Zugang zu dieser anderen Seite der Technik zu schaffen.
- Integration von Theorien: Die Begriffe haben alle eine eigene Begriffshistorie und signifikante Theoriehintergründe. Über diese Begriffe lässt sich die Reflexion von Technikgestaltung auf diese Theoriehintergründe beziehen und nach darin verhandelten Einsichten hinterfragen. So ist der Begriff der Lebenswelt prominent u.a. von Husserl behandelt und wird von uns darauf basierend gefasst als das unhinterfragte Geflecht intersubjektiv geteilter Selbstverständlichkeiten, wobei derartige Selbstverständlichkeiten sowohl operative und ggf. diskursive Sebstverständlichkeiten genauso umfassen wie symbolische Ordnungen. Beispiele für solche nicht explizit hinterfragten, sonders als Standard geteilten Selbstverständlichkeiten wären Handlungen, Gesten und Rituale (operativ), Ausdrücke, Redensarten oder Floskeln (diskursiv) des Grüßens sowie die Strukturen, die es ermöglichen bestimmte Gesten oder Worte als Grüße bedeutend (symbolisch) verstehen bzw. nicht weiter hinterfragend als üblich selbstverständlich einzuordnen. Technikgestaltung als Transformation von Lebenswelt in den Blick zu nehmen, führt so direkt zur Analyse von Selbstverständlichkeiten oder sinnlich-leiblichem Erfahrungsbezug und von dort zu Krisen (nicht nur der Wissenschaften) bzw. Herausforderungen durch Entwicklungen wie Black Boxing, Entscheidungsarchitekturen, Virtual Realities oder Metaverse. Ebensolche Wege schaffen die Begriffe Orientierung, Lebensformen und Souveränität.
- Integration von Perspektiven auf Lebenswelten: Der gewählte Begriffskonnex erlaubt es, die (auch förderlogisch) getrennten Teilcluster-Projekte inhaltlich zu verschränken, da sie aufeinander verweisen und miteinander verschränkt sind. Lebensformen bieten Orientierung für Lebensvollzüge; Lebenswelt bietet und entzieht Möglichkeiten (zu erkennen, zu entscheiden und zu handeln); gemäß der eigenen Orientiertheit und Orientierung unter Lebensformen oder unter deren Elementen situativ bedingt wählen zu können, ist Kennzeichen der Souveränität; Lebensformen sind u.a. durch die in ihnen (un)möglichen Rollen bestimmt, die wiederum Handlungen gemäß einschlägiger Mensch-, Welt- und Technikbilder orientieren.
Beispiel für Lebensformen in
Digitalisierten Lebenswelten (LeDiLe)
| Lebensformen sind Ensemble von Üblichkeiten und Normen, von Praktiken, Verstehens- und Verhaltensweisen, von Kompetenzen und Meinungen. Sie umfassen u.a. typische und habitualisierte Orientierungs- und Interpretationsrahmen, Überzeugungen, Einstellungen und Handlungsschemata mit normativem Charakter, die die kollektive Lebensführung betreffen, obwohl sie weder streng kodifiziert noch institutionell verbindlich verfasst sind. |
Zur Verdeutlichung des Konzeptes der Lebensformen besonders im Kontext der Technisierung und Digitalisierung der Lebenswelt sowie mit seinen Bezügen zu Orientierung und Souveränität seien kontrastiv der Gasriecher sowie der YouTuber vorgestellt.
Exkurs:
Dabei bietet die Perspektive der Lebensformen eine Hinsicht, bei der Lebewesen qua Gemeinsamkeiten verschiedenster Art und Menge in den Blick genommen werden. Beispielsweise stellt sie eine Hinsicht auf aquatische und fliegende (oder nachtaktive, unterirdische, anaerobe etc.) Lebensformen quer oder unabhängig zu Art-Gattungs-Verhältnissen dar. So hat die »Form« des Lebens von Walen und Fischen als aquatische Lebensformen mehr gemeinsam als die von Walen und Fledermäusen, obwohl letztere beide Säugetiere sind. Entsprechend haben Vögel und Fledermäuse als fliegende Lebensformen Gemeinsamkeiten, die Fledermaus und Wal nicht haben. Einer Lebensform gehört man an, wenn man wesentliche Bestimmungen dieser Form mit anderen gemeinsam hat und diese Bestimmungen mit dem individuellen sowie sozialen Verhalten in Wechselwirkung stehen. Dabei überschreitet die hier in LEDILE relevante Auffassung von Lebensform bloße Körperformen (etwa der Extremitäten als Flossen oder Flügel) und meint Formen des Lebens von handelnden, erleidenden, entscheidenden und (fremd-/selbst-)bestimmten Menschen.
Noch ein Exkurs:
Ein Individuum hat aus der Innenperspektive immer nur eine Lebensform, sein Leben hat eine Form, und diese Form ist so individuell wie das Individuum; allerdings empfiehlt es sich auf individueller Ebene um Sprachverwirrung vorzubeugen von Leben, Lebenslauf, Lebensvollzügen zu sprechen. Der Begriff der Lebensform (wenn auch sehr heterogen verwendet), hat ein größeres theoretisches Potenzial, wenn er auf kollektive Lebensvollzüge und deren Wechselwirkung bezogen verwendet wird. Die Perspektive auf Lebensformen (Plural) als Ensemble von Üblichkeiten etc. s.u. nutzt aus analytischer Sicht den Plural, da es viele unterschiedliche Ensemble von Praktiken und Normen etc. gibt, die in ihrer spezifischen Bündelung (d.i. diese Form) in den Blick genommen werden und genau ihre Unterschiede und ggf. Unvereinbarkeiten hervorheben zu können. So kann ein Individuum viele Rollen einnehmen, die verschiedenen Lebensformen (Plural) typischerweise zugehören und über Normierung und Orientierung an ihnen teilhaben. (Wobei vermutlich die Kompatibilität dieser Rollen und Lebensformen ein Merkmal für gelingende Orientierung sein dürfte.) Mit Orientierungskonflikten widersprüchlicher Orientierungsansprüche aus verschiedenen Rollen und Lebensformen muss umgegangen werden. Die spezifische Summe oder Mischung dieses Teilhabens, ergibt die singuläre Form dieses individuellen Lebens (dessen so und nicht anders orientierte Praktiken und Weltauffassungen).
Dimensionen, die die Form also qualifizieren, sind nicht (oder nur abgeleitet[2]) Körperformen, sondern solche mit Wirkung auf die Orientierung von Menschen in der Welt (Umwelt und Mitwelt) sowie zu sich selbst, auf die Ausprägung von Lebensvollzügen (Handlungen, Verhalten…). Es geht gemäß der Definition (siehe Kasten) nie um einzelne Handlungen oder individuelle Eigenheiten des Handelns (Stil, Macke, Spleen …), sondern um ein Bündel von Praktiken, an denen oder als Teil von denen ein Individuum sein Handeln ausrichtet. Praktiken sind dabei bezogen auf Orientierung von Handeln (eine Praktik ist ein so und nicht anders orientiertes Handeln) sowie auf das soziale Gefüge als Ordnungen sozialen Verhaltens, in die die Praktiken immer eingelassen sind. Die sozialen Ordnungen und Orientierungen von Praktiken gehen mit sozialen Erwartungen (Kooperationserwartungen und Erwartungserwartungen[3]) einher, weshalb Erwartungsbrüche, also individuelle Abweichungen der gebündelten Praktiken, von denen sanktioniert werden können, mit denen man diese Lebensform (also Praktiken-/Orientierung-/Sozialverhaltensbündel) gemeinsam hat.
Zwischen kollektiven Lebensformen und individuellen Lebensvollzügen besteht ein fundierender und wechselseitiger (nicht symmetrischer) Zusammenhang. Die Summe an bestimmten orientierten Lebensvollzügen machen als Bündel (also von anderen qualitativ abgegrenzten) die Lebensform selbst aus.[4] Eine Lebensform orientiert die Lebensvollzüge der an ihr beteiligten Individuen. Zugleich strukturiert die Lebenswelt, in der Individuen handeln und ihre Praktiken zu Lebensformen bündeln, die Bedingungen der Möglichkeit aller Lebensvollzüge und damit Lebensformen. Lebenswelt ist v.a. historisch und technisch heterogen, weswegen mögliche, gelingende Lebensvollzüge und -formen zu anderen Zeiten anders aussahen und anders möglich waren.
Gasriecher
Gasriecher war ein Beruf im 19. Jahrhundert (etwa 1820 bis 1920), dessen Funktion heute Gassensoren übernehmen, nämlich das Auffinden von Leckagen an Gasleitungen (mit einem Riechrohr an Kontrolllöchern in der Straße zu den Gasleitungen). Gasriecher war so gesehen eine professionelle Rolle in einer technisierten, nämlich industrialisierten, also mechanisierten und elektrifizierten Lebenswelt (als deren Teil Gaswerke und Stadtgasleitungen zu sehen sind). Bestimmte Lebensvollzüge, bestimmtes Wohnen, Arbeiten, Wege, öffentliche Erledigungen, Umgang mit Ämtern, Kontakt mit der Exekutive etc. waren Teil, also typisch, kollektiv geteilt, habitualisiert, einer städtischen industrialisierten Lebensform.
Der Rolle gemäß fand sich der Gasriecher in dem Spektrum möglicher Lebensvollzüge dieser Lebensform nicht am Ende der reichen großindustriellen Kapitaleigner des Zeitrahmens, indem diese Lebensform gelingend vorkam, sondern am Ende des Proletariats, der Arbeiterschaft. Entsprechend hatte das Leben, hatten die Lebensvollzüge eines Gasriechers als teilhabend an der »industriellen elektrifizierten städtischen proletarischen Lebensform« (kurz: industLF) typische Orientierung für diese Rolle dieser Lebensform in der industriellen Lebenswelt des 19. Jh. Dazu zählen (vermutlich und im exemplarischen Sinne): Erwerbstätigkeit, keine Krankenkasse (zumindest bis Ende 19. Jh.), kein Urlaubsanspruch, keine Elternzeit, keine Altersabsicherung etc. Zudem spezifische Erwartungen der Mitmenschen (Kollegen, Vorgesetzten, Bevölkerung) an Gewissenhaftigkeit, Einsatzfähigkeit, ausreichende olfaktorische Sensitivität aufgrund der Anforderungen der Rolle und der Bedeutung der Tätigkeit für die Sicherheit vieler Menschen in Ballungsräumen mit Tonnen explosiver Stoffe unter den alltäglich genutzten Straßen.
YouTuber
Entsprechend verhält es sich mit der Rolle oder dem »Beruf« des YouTubers. Diese ist einer zeitspezifischen Lebenswelt zugehörig und nur in dieser möglich, da sie neben umfassender Elektrifizierung auch umfassende Digitalisierung, Verbreitung von Abspielgeräten (jeder mindestens ein Smartphone), entsprechende plattformkapitalistische Strukturen und Bedingungen gelingender Geschäftsmodelle (vom Prinzip und Namen her aus einer anderen Lebenswelt mit Zeitungen: Werbefinanzierung, Subscriptions, Abonnenten etc.), Vernetzung, Likes etc. zum »Füttern« des Endless-Scrolling Algorithmus von YouTube usw. voraussetzt.
YouTuber (oder Video Content Creator) teilen eine bestimmte Lebensform, die sich analog zur »industriellen elektrifizierten städtischen proletarischen Lebensform« vielleicht »post-industrielle digitalisierte plattformkapitalistische kreative Lebensform« (sagen wir mal digiLF) nennen ließe (soziologisch fundiertere Bezeichnungen dürften gerade in Arbeit sein). Lebensweltliche Voraussetzung für den Plattformkapitalismus (der Voraussetzung für die Lebensform von YouTubern ist) ist das Internet (Server, Netze, Standards, Betreiber, Endgeräte etc.). Die Lebensvollzüge (hier jetzt zum Kontrastieren mal als Klischée gefasst) unterscheiden sich drastisch von denen des Gasriechers: Ausschlafen, in Schlafanzug mit Kaffee an den Rechner, Zeug auf Amazon bestellen, geliefertes Zeug vor der Kamera auspacken und kommentieren, das Ganze filmen, schneiden und posten. Statt Lohntüte algorithmische Ausschüttungen von Mikrobestandteilen enormer Werbesummen im Kampf um die Aufmerksamkeit des Gesamtbevölkerungsbildschirmkontakts (in »Star-System« [Jaron Lanier] Einzelfällen taugt das zum YouTube-Millionär). Dieser Reichtum ist (noch) nicht regelmäßiger typischer habitualisierter Bestandteil der Lebensform der YouTuber oder Content Creator (anders als die Old Money Rige oder Royals), das Narrativ davon aber durchaus (Weltvorstellungen). Insgesamt dürften die Selbstverständlichkeiten und Narrative der »digiLF« der starken Prägung durch liberal-amerikanische Valley-Player Ähnlichkeiten zu diesen aufweisen (vom Tellerwäscher zum Millionär etc.). All dies, die Arbeitsbedingungen, Verdienstmöglichkeiten (oder Utopien), die Kompetenzen (Sprechen, Videoschnitt etc.), die sozialen Erwartungen (Poster-Life, keine unordentliche Wohnung im Hintergrund, kein physisches Gehenlassen, Hochglanzanspruch) etc. orientiert die Lebensvollzüge eines YouTubers (im speziellen sowie qua Teilhabe an der digiLF) und formt sein Leben entsprechend (ob passiv hinnehmend, aktiv vermeidend, konterkarierend etc.).
Das Set an Normen, Praktiken, Orientierungen etc. der digiLF, das dem YouTuber normativ begegnet, stand in der industLF, die dem Gasriecher normativ begegnet, nicht zur Verfügung, da die Lebenswelt durch soziotechnischen Wandel eine andere ist, wovon Technisierung, Mechanisierung, Elektrifizierung, Fordismus, Digitalisierung etc. zentrale Faktoren sind. Und trotz aller Unterschiede teilen Gasriecher und YouTuber wesentliche orientierende Instanzen wie ihre Leiblichkeit – essen müssen beide, wenn auch anderes – etc. Es ist wohl auch kein Zufall, dass weder Gasriecher noch YouTuber gewerkschaftlich organisiert waren/sind. Welcher Aspekt der Lebenswelt und welche Aspekte von Lebensformen dafür als normgebend und orientierend angesehen werden können, bleibt – wie so vieles – zu untersuchen.
Beispiel für Souveränität in
Digitalisierten Lebenswelten (SoDiLe)
| Souveränität beschreibt einerseits die Summe von Fähigkeiten und Möglichkeiten von Institutionen, die ihnen auf der Ebene des Rechts zuerkannt werden. Andererseits beschreibt der Begriff auch die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Individuums, seine Rolle in der gewählten Lebensform unter den gegebenen Rahmenbedingungen selbstständig, selbstbestimmt, kompetent und sicher auszuüben. Zwischen beiden Ebenen besteht eine komplexe Interdependenz, die besonders im modernen, demokratischen Verfassungsstaat relevant ist. |
SoDiLe fokussiert empirisch und juristisch den vielerorts (auch förderpolitisch) formulierten Anspruch auf digitale Souveränität einerseits und die gelebte digitale Alltagspraxis von Jugendlichen anderseits. Eine in Marburg durchgeführte rekonstruktiv-qualitative Studie zu »Herstellungsprozessen des Selbst von Jugendlichen in digitalisierten Lebenswelten an (Gesamt-)Schulen in Hessen« ist bildungstheoretisch grundiert. Die Studie gibt erhellende Einblicke in die Selbstwahrnehmungen Jugendlicher in digitalisierten Lebenswelten, deren notwendige Orientierung als Konstruktionsprozess gerade im Kontrast zu schulischen Digitalisierungsdefiziten sowie in die Spannung zwischen digitalen Praktiken der Heranwachsenden und der Normativität von Lebensformen im schulischen Kontext.
Fünfzehn Gruppendiskussionen[5] wurden durchgeführt und mit der Dokumentarischen Methode ausgewertet[6] mit dem Ziel, die verschiedenen kollektiven Erfahrungsräume[7] von Jugendlichen in digitalisierten Lebenswelten zu rekonstruieren und eine Typologie zu rekonstruieren, die ein tieferes Verständnis von Handlungspraxen von Jugendlichen in einer digitalisierten Lebenswelt ermöglicht.
Exemplarisch können zunächst (a) für die kollektiven Erfahrungsräume der Jugendlichen am Datenmaterial die vorhandenen Spannungen gezeigt werden, die sich einerseits aus einer institutionellen Norm (nämlich der, der Schule) und anderseits der gelebten Alltagspraxis der Teilnehmenden in der Schule ergeben. Sodann (b) wird das oben eingeführte normative Begriffsinstrumentarium Lebensform, Orientierung und Souveränität zu den rekonstruierten Erfahrungsräumen der Jugendlichen ins Verhältnis gesetzt. Schließlich (c) wird nach der Diastase von Kultur der Digitalität und der defizitären Digitalisierung an Schulen in bildungstheoretischer Absicht gefragt.
Handyverbot, oder: die Eroberung der letzten analogen Insel
Dieser Auszug aus einer Gruppendiskussion gewährt einen instruktiven Einblick in die aktuell noch in der Auswertung befindliche Studie.
Geführt wurde die Gruppendiskussion an einer Realschule in einer Großstadt in Hessen mit sechs Schüler*innen parallel zum Unterricht am Vormittag. Sie dauerte 42 Minuten und verlief in Teilen selbstläufig. Trotz eines Handyverbots an der Schule nutzten die Jugendlichen auch während der Gruppendiskussion ihr Smartphone.[8]
Eine besonders dichte Interaktion stellt sich ein, wenn das Gespräch der Teilnehmenden auf das an der Schule etablierte »Handyverbot« und die damit verbundenen schulischen Sanktionen kommt. Die Passage ist besonders zur Auswertung mit der Dokumentarischen Methode[9] geeignet, weil sie eine dichte Interaktion, Beschreibungen und Erzählungen enthält.
Interviewauszug
I: Und findet ihr die Regel sinnvoll?[10]
Bm: Nein.
Em. Ë Nein.
Bm: լ Also ( ) das äh das is- halt einfach so es is- ja nich- so dass man in die Schule kommt um am Handy YouTube zu schauen oder so so hey Leute Prankboys hier oder das is- halt man das is- ja auch das is- dir halt wichtig vielleicht weil man seiner Mutter kurz schreiben muss ja Mama was gibt’s zu essen oder was machst du zu essen dies das oder wo gehst du hin bist du zuhause; so kleine schnelle Sachen das würd- glaub- ich niemanden so jucken halt aber dadurch dass es verboten is- muss man’s halt irgendwie trotzdem machen ha man is- sozusagen gezwungen, wenn man dann erwischt wird gibt’s auch noch -ne Strafe;
I: Mhm
Bm: Obwohl man’s eigentlich leise gemacht hat und
Am: Ich find’s auch richtig unnötig ich mein okay man kann das Verbot machen wenn man im Unterricht ist aber zum Beispiel in der Pause kann man’s Handy auch eigentlich benutzen ich meine is-ja jetzt nich- so als ob man jetzt jemanden aufnimmt oder -n hochläd oder so ins Internet.
I: Mhm
Am: Ich mein wenn man leise Musik hört is- ja nichts Schlimmes.
Df: Und ich glaub das bringt auch nichts weil wir sind trotzdem am Handy so.
I: Und was passiert wenn das jemand sieht von den Lehrkräften;
??. ëAlso
Em: ëAlso Handy wird eingesammelt dann wird=s im Sekretariat eingesammelt oder einfach abgegeben und dann kann man=s nach der Schule abholen und man muss so so=n zwei Seiten Brief abschreiben.
Bm: Aber der is- sehr sehr lang und sehr klein geschrieben also.
I: ëMhm
Em: Eine sehr kleine Schriftart also eine sehr kleine Schrift;
I: Und ehm und was steht dann da drin,
Bm: Da steht halt so die Handyregelung warum also dass man=s nicht machen soll und das soll man halt abschreiben die Eltern müssen unterschreiben und dann musst du das glaub ich in zwei Tagen abgeben das wird auch nicht korrigiert so ( ) machst oder nicht
??: ëmuss man bloß abgeben
I: Und und was steht da drin,
Df: Das musst du nicht unterschreiben lassen.
Bm: ëIn in dem Brief?
I: ëJa
Bm: Doch wir mussten auf alles Unterschrift.
Df: ëNein zu mir ham die gesagt
Bm: ëdoch
Df: ënein musst du nich-. einmal wurd- mir ab- abgenommen es war nicht mal Schule es war vor Schule es war nicht mal Schule hat nicht mal angefangen es war vor Schule ich war kurz am Handy und meine Mutter hat mir geschrieben weil die war an dem Tag nich- zuhause und manchmal ist sie nicht zuhause und da hat sie mir Bescheid gegeben; und dann kommt auf einmal Lehrerin von hinten und sagt mir ich soll Handy abgeben und es hat nicht mal Schule angefangen so ( )
I: Okay und was steht da drin in dem Brief?
Bm: Da steht halt drinne ehm dass man Handy in der Schulregelung nicht benutzen so und halt sowas aber sehr sehr lang ausgedrückt was da passieren kann da gab=s sogar ein Beispiel mit wo also was wenn ein LKW-Fahrer auch nur kurz auf=s Handy schaut und vergisst die Handbremse anzuziehen dann passiern da auch Folgen obwohl man nur kurz nicht aufpasst es is- schon etwas übertrieben, aber naja also es is- halt is- halt sehr sehr lang halt geschrieben das man sich schon Arbeit macht dass man sich schon quält den abzuschreiben.
Um nun gemeinsame Orientierungen zu entdecken[11], ist es notwendig sowohl nach positiven als auch negativen Horizonten[12] zu suchen. Das schulische Handyverbot wird von den Teilnehmenden durchgängig als negativer Horizont[13] konstruiert. Das Verbot kann nicht als nützlich oder verständlich eingeordnet werden. Die Beschreibungen und Erzählungen über die Art und Weise der Durchführung des Handyverbots lassen die Jugendlichen selbst im Dunkeln darüber, was der Hintergrund des Verbots sein könnte. Sie grenzen sich ebenso von den erwarteten Vorurteilen der Lehrkräfte/Schule ab, wenn sie wie Bm beschreiben, dass sie nicht »um am Handy YouTube zu schauen« in die Schule kommen.
Ein positiver Gegenhorizont deutet sich nur an jenen Stellen an, die eine Alltagspraxis abseits der Schule formulieren, z.B. das Kontaktaufnehmen zu anderen oder peerkulturelle Aktivitäten wie z.B. Musik hören. Die Teilnehmer*innen teilen einen gemeinsamen schulischen Erfahrungsraum, in welchem das Smartphone trotz des normativen Verbots der Schule gleichsam zur alltäglichen digitalen Erfahrung innerhalb der Schule gehört. Es besteht also eine erhebliche Spannung zwischen der Propositionalen Logik, d.h. der institutionalisierten normativen Erwartung der Schule, dass nämlich alle Handys/Smartphones am besten zuhause oder ausgeschaltet in der Schultasche bleiben sollten, und der performativen Logik, nämlich der Handlungspraxis der Schüler*innen, die ihr Handy/Smartphone wie in allen anderen Lebensbereichen selbstverständlich auch in der Schule nutzen.
Da kein positiver Gegenhorizont rekonstruiert werden kann, sondern lediglich ein negativer (schulische Verbotspraxis), führt dies bei den Jugendlichen zu einem Orientierungsdilemma, da es aufgrund der eigenen digitalen Handlungspraxis scheinbar keine Realisierungsmöglichkeit für die Teilnehmenden gibt, die sie sinnvoll praktizieren könnten. Dieses Orientierungsdilemma der Teilnehmenden zeigt sich nicht nur in dieser exemplarischen Textpassage, sondern in allen Gruppendiskussionen. Immer dann, wenn der schulische Erfahrungsraum hinzutritt, erscheint dieser als »letzte« analoge Insel in der digitalen Lebenswelt der Jugendlichen.[14]
Integrierte Forschung, die Souveränität, Orientierung und Lebensformen in digitalisierten Lebenswelten als einen Beitrag zu einem Forschungsmodus, der einerseits diesen neu entstehenden Mensch-Technik-Verhältnissen entspricht und andererseits es ermöglicht, die Verantwortung für ein Leben in digitalisierten Lebenswelten in Forschung und Entwicklung konkret wahrnehmen zu können, muss diese prinzipiellen Konfliktfelder und Spannungen differenziert wahrnehmen – gerade wenn auch eine bildungstheoretisch-anthropologische Perspektive sinnvoll erscheint.
Gerade die im Projekt gewählten Begriffe der Lebensform, der Orientierung und der Souveränität können anhand der Analyse von Handlungspraxen in einer digitalisierten Welt in ein wechselseitig spannungsvolles Verhältnis gesetzt werden, in welchem die Begriffe auf Ihre Anwendbarkeit und Plausibilisierung in verschiedenen Formen alltäglicher Praxis überprüft und dadurch modifiziert werden können.
Beispiel für Orientierung in
Digitalisierten Lebenswelten (OrDiLe)
| Orientierung beschreibt einen Grundvollzug von Lebewesen. Sie reicht von sehr basaler morphologischer Ausrichtung bis zu äußerst komplexen physiologischen, topologischen oder intellektuellen Akten von fundamentaler Bedeutung für Lebewesen und ihre soziale Ordnung. Orientierung ist ein inkrementeller, unabschließbarer Prozess, der Orientiertheit voraussetzt und von hier aus sich zu neuer Orientierung abstößt. Orientierung im menschlichen Bereich unterliegt zunehmend der eigenen Konstruktion – und damit der Verantwortung. |
Während im Bereich der kommerziellen Robotik der Schwerpunkt auf der Konstruktion und Produktion von Industrie- und Servicerobotik liegt, werden derzeit im Rahmen BMBF-geförderter Forschungs- und Entwicklungsprojekte Versuche unterstützt, robotische Systeme in weitere gesellschaftliche Bereiche einzuführen. Dabei steht vor allem die soziale Interaktion zwischen Menschen und Robotern im Fokus.[15] Wie im Produktions- und Servicebereich sollen die Roboter Aufgaben übernehmen bzw. dabei assistieren – allerdings ist weniger scharf umrissen, was als Aufgabe zugewiesen werden bzw. worin der konkrete Beitrag robotischer Assistenz in sozialen Interaktionen liegen kann.
Die Einführung von sozialer Robotik in Krankenhäuser, Pflege- und Bildungseinrichtungen oder auch in der privaten Häuslichkeit ist konfrontiert mit einer Vielzahl von Herausforderungen, die nicht nur technischer Natur sind, sondern Fragen der Gestaltung sozialer Beziehungen[16] betreffen. Hierzu ist es unerlässlich, relevante Wissenschaftsdisziplinen wie Anthropologie, Psychologie, Soziologie oder Ethik (um nur einige zu nennen) hinzuzuziehen. Der Einsatz robotischer Systeme in der Interaktion mit Menschen erfordert eine präzise Analyse der avisierten Einsatzfelder auf ihre sozialen Determinanten (Normen, Werte, Konventionen, …) und Ziele, um die Rekonstruktion von bisher Mensch-Mensch-Interaktion oder Mensch-Tier-Interaktion in einer Mensch-Roboter-Interaktion ›nachzubauen‹. Im Falle völlig neuer Interaktionsformen ist eine Analyse erforderlich, an welche Üblichkeiten menschlicherseits angeschlossen werden kann bzw. was menschlicherseits gelernt werden muss, um interagieren zu können.
Damit werden Fragen nach erstrebenswerten bzw. unerwünschten Effekten dieser neuen Interaktionen auf menschliche Lebensvollzüge auf der individuellen wie der kollektiven Ebene aufgeworfen. Diese lassen sich als pragmatische, aber auch sehr fundamentale Orientierungsfragen begreifen, für die das hier vorgestellte Raster mit den Leitbegriffen Orientierung – Lebensformen – Souveränität eine multiperspektivische Analyse und Evaluation zur Gestaltung solcher Interaktionen eröffnet.
Die Integration einer technischen Entität in menschliche Interaktionskontexte fordert unser etabliertes Verständnis von Interaktionen heraus und lässt unser gängiges Orientierungswissen bezüglich des Verständnisses der Interaktionspartner und geeigneter Interaktionsmodi fraglich werden. Es wird deutlich, dass etablierte Vorstellungen aus dem Bereich zwischenmenschlicher Interaktion auf (meist impliziten) Voraussetzungen beruhen, die nicht unhinterfragt und reibungslos auf Mensch-Roboter-Interaktionen übertragen werden können. Dieses Orientierungswissen wird z.B. durch Fragen herausgefordert wie z.B.
- Wie kann ein Roboter als Interaktionspartner gedacht werden?
- Worin unterscheiden sich Mensch und Roboter?
- Welche Fähigkeiten und welche Limitationen zeichnen das robotische System aus?
- Welche Formen von Sozialität können/sollen zwischen Mensch und Roboter entstehen?
- Welche Formen wären wünschenswert? Welche illegitim? Und warum?
- Können und sollen robotische Systeme menschliche Emotionen erkennen?
- Wie sollen sie auf diese reagieren?
- Wie verändert der Einsatz von robotischen Systemen menschliche Lebensformen?
- Wie können sinnvolle und verantwortbare Einsatzkontexte identifiziert werden?
- Welchen Möglichkeitsbedingungen (technischer und nicht-technischer Natur) unterliegt der Einsatz von ›sozialen‹ Robotern?
Die Bandbreite der Fragen lässt sich hierbei als Hinweis auf die Reichweite der Transformation der Lebensvollzüge (wie z.B. in der Pflege) durch deren Robotisierung verstehen. Gerade die unhinterfragten Selbstverständlichkeiten, aber auch die Praktiken der Lebenswelt, die aktuell nur in geringem Umfang technisiert sind (wie bspw. Pflege oder Kinderbetreuung), werden durch den Einsatz von robotischen Systemen in Frage gestellt, wodurch Orientierungsprobleme, Ängste und Widerstände entstehen. Um diese in konstruktiver Form beantworten zu können und verantwortbare Gestaltungsoptionen und Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren, muss deren Ursache untersucht werden.
Eine mögliche Ursache könnte in der konstruierten ›Sozialität‹ der Roboter liegen, die das technische System nicht mehr als reines Werkzeug, sondern als Interaktionspartner in Erscheinung treten lässt. Das traditionell eingeübte Interpretationsmuster von Mensch-Technik-Relationen versteht den Menschen als souveränen Gestalter und Nutzer von Technik, der durch den Einsatz eines technischen Instruments seine eigenen Zielsetzungen verwirklicht. Diese durch Asymmetrie gekennzeichnete Relation und deren Interpretation kann nicht einfach auf Interaktionen mit ›sozialen‹ Robotern übertragen werden, die eben gerade nicht als Instrument, sondern als Gegenüber, als ›Partner‹, als ›Trainer‹ oder ‹Lehrer/Schüler‹ o.a.[17], konstruiert werden. Die aktuell in Konstruktion und Erprobung befindlichen Roboter haben nicht nur einen anderen Einsatzkontext als Industrie- oder Serviceroboter, sondern ihnen werden spezifische Rollen bzw. Status zugeschrieben (genauer: konstruiert), wodurch Fragen nach menschlicher Souveränität in der Interaktion mit ihnen aufgeworfen werden und so die impliziten Voraussetzungen von Interaktionen und Lebensformen fraglich werden.
Der Einsatz ›sozialer Roboter‹ forciert ein Explizieren der Selbstverständlichkeiten der Lebenswelt und eine bewusste Reflexion auf unhinterfragt gültiges Orientierungswissen über das Verhältnis von Mensch und Technik, ebenso wie eine Infragestellung von Ideen (un-)bedingter Souveränität. Der Anspruch, Technik als sozial kompetent und emotional sensitiv zu konstruieren, erweist sich nicht nur als technische Herausforderung (wobei auch in diesem Bereich viele ungeklärte Fragen bestehen), sondern konfrontiert uns Menschen mit der Notwendigkeit die Grundlagen unseres Zusammenlebens und -arbeitens und hierbei unser moralisches Selbstverständnis in Beziehungen zu explizieren. Diese Explikation kann als Basis einer ethischen Evaluation dienen, die erst dann sinnvoll und gewinnbringend vollzogen werden kann, wenn klar und differenziert in Erscheinung tritt, worüber und woraufhin geurteilt werden soll. Ein differenziertes Verständnis der jeweiligen Kontexte, sozialen Rollen und damit gekoppelt Erwartungshaltungen lässt die Fragen nach Chancen und Grenzen von Technisierung in Bezug auf Lebensformen differenzierter stellen. Durch diese Differenzierung und Kontextualisierung können pauschalisierende (meist auch emotionalisierende) Urteile über technische Systeme (Roboter sind per se gut bzw. schlecht) ebenso vermieden werden wie die Konstruktion praxisferner, nicht anschlussfähiger technischer Systeme.
Zusammenfassende Überlegungen
Die Gestaltung von Technik in digitalisierten Lebenswelten stellt sich auf einer gesellschaftlichen Ebene (Makroebene) als eine Frage der Orientierung, woraufhin die Technik gestaltet werden sollte. Dieses Woraufhin artikuliert sich in einer sehr grundlegenden Weise in der Offenheit für verschiedene individuelle Lebensformen und einer Lebenswelt, die für (idealiter) Alle wünschbare Optionen bereithält. Auf der Mesoebene der Organisationen wiederholen sich diese Fragen in einer kleineren Reichweite und anderen Regulierungsform. Auf der Mikroebene individueller Lebensverläufe stellt sich die Frage nach der Wahlmöglichkeit mit und durch bestimmte Technik und im Gegenüber bzw. Miteinander anderer Lebensformen. Orientierungsfragen sind auf allen diesen Ebenen auch Verantwortungsfragen. Verantwortung kann dann wahrgenommen werden, wenn effektive und informierte Wahlalternativen vorliegen und wenn Stimmrecht für die Aushandlung der zur Debatte stehenden Technikgestaltungsprozesse auf den jeweiligen Ebenen gegeben ist. Das impliziert eine an Partizipation und Integration orientierte Forschung.
Souverän wäre in diesem Kontext nun ein Individuum zu nennen (und für Organisationen und Staaten gilt das in analoger Weise), das aufgrund informierter Orientiertheit sich im Norm- und Sanktionsgefüge orientieren und nach diesen Orientierungen nach als eigenen anerkannten Werten/Präferenzen handeln kann. Da Handeln nie einfach so orientiert und wie orientiert ausgeführt werden kann, sondern immer mit Widerständigkeit und Hemmnissen konfrontiert ist, besteht die Souveränität eines Individuums auch darin, gegenüber diesen Hemmnissen eine Haltung finden, einüben und durchhalten zu können, die es erlaubt zwischen Wahl und Fremdbestimmung, zwischen Autonomie und Hemmnissen, zwischen aktiver Anerkennung von und passivem (historisch kontingentem) Betroffensein durch Lebensformen auszubalancieren. Souverän wäre ferner nun ein Kollektiv, dem es gelingt unter den historischen Vorgegebenheiten der jeweiligen geschichtlichen und geografischen Lage, zwischen fundierenden Strukturen und Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen so zu manövrieren, dass sich das Optionsgefüge der Lebenswelt in (stets auszuhandelnde) wünschenswerte und präferierte Strukturen entwickelt, d.h. zu einer Struktur (einem orientierenden Optionenangebot), die ein Bündel gelingender Lebensformen für alle beteiligten Kollektive bereit hält. Diese Lebensformen hätten dann wiederum eine wünschenswerte Struktur, wenn sie Bündel von Lebensvollzügen ermöglichen, die sowohl den Präferenzen der Individuen als auch der Passfähigkeit der Orientierungen der Lebensformen untereinander gerecht werden.
An dieser Stelle kann nur – ohne größere Ausführungen – darauf hingewiesen werden, dass die vorgestellten Überlegungen in einer von Digitalisierung bestimmten Welt mit neuen und zunehmend ›eigensinnig‹ agierenden technischen Interaktionspartnern diese Herausforderungen noch einmal steigert. Technik so zu gestalten, dass sie dem einzelnen Menschen dient und sich förderlich auf das Zusammenleben der vielen, verschiedenen Menschen auswirkt, ist für sich schon eine große Herausforderung. In digitalisierten Lebenswelten aber, von denen jede/r nolens volens betroffen ist, und in denen Empfehlungen, Entscheidungen, Alltagshandlungen zunehmend von technischen Systemen begleitet, unterstützt oder auch ersetzt werden, steigert sich diese aber noch einmal. So gesehen rückt Technik (oder deren Gestalter, Betreiber etc. mittels Technik) in die Wirkposition von kollektiven Lebensformen ein, wo sie Üblichkeiten prägt, Handeln orientiert, Rollen zuweist… Technik ist so eine dominante Kraft der Lebenswelt wo sie nämlich Selbstverständlichkeiten strukturiert und Hinterfragen erschwert bzw. Hinterfragbarkeit systemisch entzieht. Der Durchdringungsgrad und die Reichweite digitaler Technik ist eminent gesteigert und damit auch das Risiko von Ausfällen, Fehlern oder unerwünschten Nebenwirkungen. Fragen der Verantwortung im Zusammenwirken mit technisch autonomen oder automatisierten Systemen sind komplexer und aufwendiger zu beantworten. Damit sind Fragen des Einbezugs von Betroffenen (wer ist nicht betroffen?) bereits in der Forschung und Entwicklung und nicht erst bei der Anwendung virulent. Um diese Fragen – nach bestem Wissen und Gewissen – zu beantworten, sind Forschungsmodalitäten notwendig, wie sie hier in der Integrierten Forschung entwickelt und erprobt werden.
Autorinnen und Autoren:
Dr. Galia Assadi, Evangelische Hochschule Nürnberg
Prof. Dr. Axel Benning, Hochschule Bielefeld
Rubin Comparot, KIT Karlsruhe
Abdulmuttalip Erduran, Hochschule Bielefeld
PD Dr. Bruno Gransche, KIT Karlsruhe
Prof. Dr. Arne Manzeschke, Evangelische Hochschule Nürnberg
Julia Marburger, Philipps-Universität Marburg
Prof. Dr. Marcell Sass,Philipps-Universität Marburg
Silke Schulz-Pabst, Hochschule Bielefeld
Sonja Spörl, TU Braunschweig
Prof. Dr. Jochen Steil, TU Braunschweig
[1] Zum Begriff der Lebenswelt besonders der Frage nach Lebenswelt im Singular oder Lebenswelten im Plural bzw. in weiter oder enger Begriffsfassung vgl. die Ausführungen hier: https://youtu.be/qjOmDHuOd9Y?feature=shared, 2:56-6:56, besonders ab 4:30.
[2] Etwa Hard Bodies, Supermodels etc.
[3] Das sind Erwartungen über die Erwartungen von Anderen, mit denen kooperiert wird. So ist für gelingende Kooperation (bspw. im Militär) nicht nur relevant, dass A von B erwartet, dass B seinem Befehl folgt, sondern dass auch B erwartet, dass A erstere Erwartungen ihm gegenüber hat usw.
[4] So wie ein Bündel Spaghetti aus den einzelnen Spaghetti besteht, ohne dass eine einzelne Nudel, das Bündel bestimmte oder ihre einzelne Abweichung oder gar Fehlen dieses Bündel Spaghetti zu einer anderen Nudelform werden ließe. Also: Spaghetti und Linguine sind verschiedene Nudelformen, jedoch beide der Nudelform Langnudeln (pasta lungha) etwa im Gegensatz zu Pasta corta wie Penne. Eine Linguine in einem Bündel Spaghetti macht aus diesem Spaghettibündel kein Linguinebündel. Jenseits der gemeinsamen physischen Form wären Dinkelspaghetti eine andere Nudelform als Hartweizengrießspaghetti. Etc.
[5] Die Geschichte der Gruppendiskussion als qualitative Sozialforschung mit ihren verschiedenen methodischen Akzentsetzungen sind eng an die zeitgeschichtlichen Entwicklungen der qualitativen Empirischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland gebunden. Einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Gruppendiskussion und ihrer jeweiligen methodischen Akzentsetzung bietet der Artikel »Gruppendiskussionen«. Vgl. Bohnsack, Ralf, Gruppendiskussionen, in: Uwe Flick; Ernst von Kardorff; Ines Steinecke (Hg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch, 14. Auflage, 2022, 369-384.
[6] Die Dokumentarische Methode gehört zu einer der etabliertesten qualitativ-rekonstruktiven Methoden im Bereich der Schul- und Professionsforschung. Sie wurde in Deutschland von Ralf Bohnsack im Rückgriff auf Erkenntnisse der Praxeologischen Wissenssoziologie, wie sie Karl Mannheim geprägt hat, für die Analyse von Gruppendiskussionen entwickelt und über die letzten 20 Jahre stetig weiterentwickelt. Die Methode ist besonders geeignet, kollektive Erfahrungen und Handlungspraxen zu rekonstruieren. Dazu müssen verschiedene voneinander getrennte Schritte durchgeführt werden. So wird in einer Gruppendiskussion z.B. die formulierende Interpretation von der reflektierenden Interpretation getrennt behandelt. Unter formulierende Interpretation versteht man das, was auf der expliziten Ebene von den Teilnehmenden gesagt wird. Unter der reflektierenden Interpretation versteht man, wie das Gesagte also die jeweiligen Textsequenzen aufeinander bezogen sind. Vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch, 5. überarbeitete und erweiterte Auflage, 348-395.
[7] Unter konjunktivem Erfahrungsraum »wird das menschliche Miteinandersein, das sich in der gelebten Praxis fraglos und selbstverständlich vollzieht,« gefasst. Das Wissen, das in der Praxis angeeignet wird und das diese Praxis zugleich orientiert, ist damit ein präreflexives, »atheoretisches Wissen« (Mannheim 1964; 100).« Siehe Przyborski, Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch, 359 f.
[8] Ein »Handyverbot« herrschte an allen Schulen, die Teil der Studie waren. Bei allen Gruppendiskussionen wurde ebenso von den Teilnehmenden darauf aufmerksam gemacht, dass sie »selbstverständlich« ihr Smartphone auch während der Schule dabeihaben und es auch nutzen.
[9] Przyborski, , Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch, 5. überarbeitete und erweiterte Auflage, Oldenburg 2021.
[10] Die Transkription erfolgte gemäß der »Talk in Qualitative Social Research« (TiQ). Das Transkript wurde anhand einer Audioaufnahme erstellt und entspricht dem wortwörtlichen Verlauf des Gesprächs. Das im folgenden Transkript mehrfach auftretende Gleichheitszeichen zeigt jeweils eine Wortverschleifung an und entspricht den Transkriptionsregeln der TiQ.
[11] »Mit Orientierungen sind Sinnmuster gemeint, die unterschiedliche (einzelne) Handlungen hervorbringen. Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch, 371. Diese Orientierungen zeigen sich auf der immanenten Ebene und werden gerade nicht auf der expliziten Ebene über Themen direkt angesprochen; das ist für das grundsätzliche Verständnis der Methode wichtig hervorzuheben. Gemeinsame Orientierungen zeigen sich also dort, wo man sich auch ohne viele Worte versteht, und zwar weil man z.B. bestimmte Erfahrungen miteinander teilt. Vgl. ausführlich Przyborski, Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch, 371-380.
[12] Mit positivem und negativem Horizont ist gemeint, welche Bestrebungen zeigen sich in den Redezügen, wo und welche Abgrenzungen werden in den Redezügen implizit zum Ausdruck gebracht? Normalerweise wird ein positiver Horizont von einem negativen Gegenhorizont begrenzt, sodass man dadurch die Möglichkeit erhält, mögliche Orientierungen rekonstruieren zu können. Bleibt ein positiver Horizont aus, so deutet dies auf ein sog. Orientierungsdilemma hin, d.h. es wird keine Realisierungsmöglichkeit für die Umsetzung gesehen. Przyborski, Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch, 371-380.
[13] Unter einem negativen Horizont versteht man die Abgrenzung der Teilnehmenden von einer bestimmten Handlungspraxis. Der positive Horizont, kann als dass beschrieben werden, wohin der Text strebt.
[14] Das zeigt sich in allen geführten Gruppendiskussionen, sobald das Gespräch auf den Erfahrungsraum Schule kommt.
[15] So sollen mit »interaktiven Assistenzrobotern« »geeignete Interaktionslösungen für jede Alltagssituation« bzw. »flexible und leistungsfähige Lösungen für eine optimale Interaktion von Menschen mit Robotern« entwickelt werden; https://www.interaktive-technologien.de/foerderung/bekanntmachungen/ra3
[16] Als solche sind Interaktionen mit Robotern zu verstehen, wobei ›sozial‹ eine große Bandbreite von Graden aufweist: der Einsatz minimaler sozialer Signale zur Sprach- oder Gestensteuerung des robotischen Systems bis hin zu emotionaler Kommunikation auf der Basis ›ausgelesener‹ menschlicher Emotionen und simulierter Emotionen auf der Seite des zumeist humanoid oder zoomorph gestalteten Roboters.
[17] Vgl. Manzeschke, Arne, und Galia Assadi. »Emotionen in der Mensch-Maschine-Interaktion«. In Mensch-Maschine-Interaktion. Handbuch zu Geschichte – Kultur – Ethik, hrsg. von Kevin Liggieri und Oliver Müller, Berlin: J. B. Metzler, 2019, S. 165–171.